
Fast zwanzig Jahre Berufserfahrung, unzählige Konzerte - von Orchestergräben über Soloauftritte bis hin zu Bands:
Als ich mit 18 mein klassisches Cello-Studium an der Hochschule für Musik in Weimar begonnen habe, war ich - wie viele meiner Kommiliton:innen - fest davon überzeugt: Wenn ich nur hart genug übe und mein Instrument perfekt beherrsche, wird sich der Rest schon irgendwie von alleine fügen. Spoiler: Hat er nicht.
Das Studium hat mich technisch und musikalisch enorm geprägt - keine Frage. Aber auf das echte Leben als freischaffende Musikerin hat es mich nur zu einem Bruchteil vorbereitet. Damals hielt ich Prüfungen, Eignungstests und Probespielen für die großen Hürden. Heute weiß ich: Die wirklichen Herausforderungen beginnen erst nach dem Abschluss.
Aber mit diesen Herausforderungen kam auch etwas anderes: die größte Freiheit. Die Freiheit, meine eigene Musik zu machen. Meinen eigenen Weg zu gehen. Eigene Konzerte zu spielen und eigene Ensembles zu gründen. Ein Glück, welches ich mir damals nicht hätte vorstellen können - aber wegen dem allein es sich schon lohnt, weiter zu machen.
Hier sind 10 Dinge, die ich erst im "echten Leben" gelernt habe - manchmal auf die harte Tour, aber inzwischen mit einem Grinsen im Gesicht:
1. selbst Musik machen
Improvisieren, eigene Songs schreiben, Loopen, Arrangieren - das alles war im klassischen Studium kein Thema. Ich konnte zwar Haydn perfekt interpretieren und hab stundenlang über Bach's Urtext gebrütet, aber meinen ersten eigenen Song? Ich hätte gar nicht gewusst, wo ich da überhaupt anfangen sollte.
Die klassische Ausbildung lehrte mich, Partituren zu vergleichen, Anweisungen der Komponisten zu respektieren, nichts zu verändern. Heute frage ich mich manchmal, ob die toten Komponist:innen das wirklich so gewollt hätten, dass man ihre Werke immer nur auf eine bestimmte Weise spielt. Ich jedenfalls liebe es, wenn meine Musik neu gedacht wird - auf anderen Instrumenten, mit frischen Harmonien oder Ideen, auf die ich selbst nie gekommen wäre. Davon lebt Musik!
Meine eigene musikalische Sprache habe ich erst nach dem Studium gefunden - mit einer Jazz-Weiterbildung, etlichen Impro-Sessions, Selbststudium im Loopen und mit Effektpedalen, dem Austesten von E-Cello und anderen Instrumenten, mit populärem Gesang und dem ständigen Austausch mit Kolleg:innen aus allen möglichen Bereichen. Denn genau diese Offenheit hält meine Musik lebendig.
2. Timing & Groove
Im Pop oder Jazz zählt jede Millisekunde. Im klassischen Studium? Da ging's um Ausdruck, Phrasierung, große Bögen - aber nicht darum, tight zu spielen. Klar, man übt mal mit Metronom, aber es ist einfach eine andere Welt. Kein klassisches Orchester ist wirklich tight.
Ein Pop-Drummer groovt anders, weil er nicht einem Dirigenten folgt, sondern die Band ihm. Swingende Achtel, Synkopen, Claves - das ist wie ein neues Muskelgedächtnis. Fast so, als würde ein Eiskunstläufer plötzlich Breakdance lernen.
Wenn es richtig groovt, entsteht diese mitreißende Energie, die dich fast aus dem Stuhl hebt. Dieses Gefühl, gemeinsam im Beat zu sein, ist befreiend - und ich hätte es gerne schon viel
früher für mich entdeckt.
3. Selbstvermarktung
Keine Website, kein Social Media - keine Konzerte. Das hat uns niemand gesagt.
In der Klassik-Ausbildung schwingt oft still die Annahme mit: Talent reicht. Wenn du gut bist, fleißig deine 5-8 Stunden am Tag übst, wird dich schon ein Orchester oder eine Musikschule auffangen. Aber was, wenn du für keines von beiden gemacht bist?
Irgendwann habe ich gelernt: Sichtbarkeit ist heute genauso wichtig wie Können - vielleicht sogar wichtiger. Plötzlich war ich nicht nur Musikerin, sondern auch mein eigenes Label, meine eigene PR-Abteilung, mein eigener Social-Media-Manager. Es geht nicht darum, sich "zu verkaufen", sondern darum, dass deine Kunst überhaupt gesehen wird. Ohne diese Sichtbarkeit existierst du einfach nicht - egal, wie gut du spielst.
4. Booking & Akquise
Oft ist die größte Hürde nicht das Spielen, sondern überhaupt gebucht zu werden. Niemand hat mir im Studium erklärt, wie man Veranstalter überzeugt, welche Videos sie sehen wollen oder wie man Referenzen sammelt, um Vertrauen aufzubauen. Ich dachte lange, gute Musik spricht sich von selbst herum. Tut sie aber nicht.
Stattdessen lernte ich, knackige Mails zu schreiben, professionell nachzuhaken, mein Pressematerial selbst zu kuratieren - und darauf zu achten, dass Veranstalter nicht einfach irgendein Foto aus dem Internet oder gar KI-generierte Texte nehmen.
Genauso wichtig: Gagen klar zu verhandeln. Das ist nicht unhöflich, sondern professionell. Wer seinen Wert nicht klar kommuniziert, wird oft unter Wert gebucht - und das liegt dann nicht an "der Branche", sondern daran, dass man nicht verhandelt hat.
5. Recording & Technik
Als ich meine erste Aufnahme selbst produzieren wollte, dachte ich: Mikro hinstellen, irgendwo anschließen, Aufnahme drücken - fertig. Die Realität: Es gibt gefühlt 57345 Mikrofontypen mit völlig unterschiedlichen Einsatzbereichen (Studio, Live, Kugel, Niere, Superniere, Kondensator, Bändchen, Dynamisch...) und Klangcharakteren. Dazu Audio-Interfaces, DAWs, Plugins, Soundpanels, Bit-Rate, Mastering-Standards - und keinen einzigen Satz dazu im Studium.
Also habe ich gelernt: durch Kolleg:innen, durch stundenlange Recherche, Online-Kurse, Learning by Doing - und leider auch durch ein paar teure Fehlkäufe. Heute kann ich (bis auf Mix & Mastering) meine Musik selbst professionell aufnehmen, veröffentlichen und streamen - und ich weiß genau, was ich will, wenn ich mit Tontechniker:innen arbeite.
6. Zielgruppe finden
Im Studium war mein Wert als Musikerin direkt daran gekoppelt, wie fehlerfrei ich vor Professor:innen und Mitstudierenden spielte. Kein Wunder, dass mein Lampenfieber später in Probespielen eher größer als kleiner wurde - da ging es immer um Leistung, nie darum, ob die Musik berührt.
Ironischerweise stehe ich heute vor 2000 Menschen auf der Popbühne viel entspannter als damals im Klassikraum. Warum? Weil diese Leute einfach nur berührt werden wollen. Sie nicht darauf warten, dass ich gleich einen Fehler mache. Nicht jede Note auf die Goldwaage legen.
Also merke dir: Deine Kollegen sind nicht deine Zielgruppe. Und auch nicht jeder, der dir auf Instagram folgt. Zu wissen, für wen ich wirklich spiele, war für mich ein Wendepunkt - der wahre Gamechanger.
7. Karriere-Mix
Die romantische Vorstellung von der klaren, geraden Musikerkarriere? Schön, aber selten Realität - vor allem als Selbständige. Mein Berufsleben ist eher ein bunter Flickenteppich aus Orchesterjobs, Unterricht, Studioarbeit, Crossover-Projekten und meinen eigenen Songs.
Mal steht ein Baustein im Rampenlicht, mal ein anderer. Wer sich nur auf eine Einnahmequelle verlässt, steht schnell mit leeren Händen da, wenn ein Engagement platzt. Der Mix macht nicht nur finanziell stabiler, sondern auch künstlerisch freier.
8. Finanzen & Recht
Steuern, Umsatzsteuerbefreiung, Voranmeldungen, Verträge aufsetzen, Gagen richtig kalkulieren, Instrumentenversicherung - all das hat mir zu Beginn ordentlich Kopfschmerzen gemacht. An der Hochschule? Fehlanzeige. In der Realität? Überlebenswichtig.
Zum Glück habe ich keine teuren Fehler gemacht, weil ich Verträge nicht verstanden oder zu spät verhandelt habe. Trotzdem hätte ich oft selbstbewusster auftreten und mehr für mich rausholen können. Heute weiß ich: Finanzielles und rechtliches Know-how ist kein lästiger Nebenschauplatz, sondern ein Teil meiner künstlerischen Freiheit. Wer da gut aufgestellt ist, kann kreativer arbeiten.
9. Publikum begeistern
Im Klassikstudium lag der Fokus auf makelloser Technik. Doch auf der Bühne habe ich schnell gemerkt: Die Leute erinnern sich selten an jede perfekt gespielte Passage (außer sie lernen gerade selbst das Stück), sondern daran, wie sie sich dabei gefühlt haben.
Bühnenpräsenz, Augenkontakt, natürliche Bewegungen, spontane Momente - das macht ein Konzert erst unvergesslich. Schauspieler haben ja auch kein Drehbuch in der Hand. Für mich hat das Auswendigspielen ganz neue Türen geöffnet: Plötzlich war ich viel freier, konnte die Musik besser verstehen und sie viel persönlicher gestalten. Und ich kann viel spontaner auf das Publikum reagieren, das an jedem Abend anders ist - und das bewegt mehr als ein makelloser Ton.
10. Wert kennen und verhandeln
Einer meiner größten Aha-Momente: In der Klassik sind Gagen oft niedriger, Aufstiegschancen kleiner, und Sitzordnungs-Machtkämpfe größer - obwohl das Publikum meist zahlungskräftig ist.
Mittlerweile weiß ich: Die Gage, die ich ansetze, definiert meinen Wert. Wer sie nicht zahlen will, ist nicht mein Kunde, sondern jemand, der gute Arbeit zum Schnäppchenpreis haben will.
Es war ein langer Weg, diese Haltung zu verinnerlichen und konsequent "Nein" zu schlecht bezahlten Muggen zu sagen. Aber es hat mein Berufsleben verändert. Selbstwert ist kein Luxus, sondern die Grundlage, um langfristig im Musikbusiness bestehen zu können - und irgendwann hoffentlich auch mal eine Rente zu kriegen. Ich kenne zu viele Kolleg:innen, die das vergessen haben und in Altersarmut landen werden.
Fazit: Musik studieren ist nur der Anfang - die wahre Arbeit beginnt danach
Mein klassisches Cello-Studium hat mir viele wertvolle Grundlagen vermittelt - Technik, Interpretation, musikalische Tiefe. Aber das Leben als Musikerin? Das ist nochmal eine ganz andere Partitur. Eigene Musik schreiben, den Groove wirklich spüren, sichtbar werden, eigene Konzerte organisieren, technische Skills aufbauen, die richtige Zielgruppe finden, verschiedene Jobs jonglieren, Finanzen managen, Publikum begeistern und den eigenen Wert vertreten - all das musste ich mir nach dem Studium Schritt für Schritt erarbeiten.
Das mag auf den ersten Blick überwältigend klingen, aber genau darin steckt auch eine große Freiheit. Musik kennt keine Grenzen und keine starren Wege. Wer bereit ist, über die klassische Ausbildung hinauszuschauen, kann sich eine Karriere aufbauen, die wirklich passt - mit all ihren Facetten und Chancen.
Und selbst diese 10 Punkte sind nur die halbe Wahrheit. Denn dann gibt es noch diese Backstage-Momente, fünf Minuten vor Showbeginn, Tränen im Gesicht - und trotzdem gehst du mit dem strahlendsten Lächeln auf die Bühne und spielst. Situationen, in denen Menschen aus deinem engsten Kreis dir Steine in den Weg legen - oder du dich über Zugausfälle, Konzertabsagen und andere Dinge ärgerst. Und trotzdem packst du dein Cello aus, stimmst - und spielst.
Ein Kollege hat es neulich so formuliert:
"Da ist sooooooo viel, was uns das Studium nicht lehrte. Aber mein Cello war, ist und bleibt mein bester Freund, Liebe, Glück, Schutzengel, Vertrauter, Partner auf meinem Rücken und vor
der Brust. Loyal und immer für mich da!!" Ich hätte es nicht schöner ausdrücken können.
Denn genau das ist der Kern: Ja, es gibt harte Momente - manchmal richtig harte. Aber es gibt auch diese unerschütterliche Liebe zur Musik. Die Freiheit, eigene Konzerte zu spielen, die es ohne mich nie gegeben hätte. Freiheit, die manchmal schwindelerregend ist... und gleichzeitig das Beste an meinem Beruf.
Ich hoffe, dieser Einblick zeigt dir, wie vielseitig, chaotisch und großartig das Leben als Musiker:in sein kann - und macht dir Mut, deine Träume mit einem Augenzwinkern und viel Herzblut zu verfolgen. Denn am Ende zählt nicht das perfekte Spiel, sondern die Musik, die von Herzen kommt und uns alle verbindet.
Welcher Punkt spricht dich am meisten an? Oder was hast du selbst Neues gelernt, das im Studium nie Thema war?
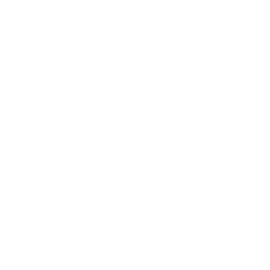

Kommentar schreiben
Sylvia Vietze (Montag, 11 August 2025 06:39)
Liebe Mara, Du bist so eine vielseitige Künstlerin, �. Geh Deinen Weg, verfolge Dein Ziel unbeirrt weiter. Du hast schon soviel geschafft in Deinem Leben, wenn der Weg auch steinig ist, jeder Stein, den Du dir selbst aus dem Weg räumst, bringt Dich Deinem Ziel näher und macht Dich nur stärker.��������